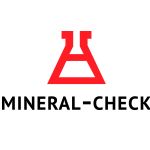Bluttests für Schwermetalle und Mineralstoffe
Blutuntersuchungen (Bluttests) gelten als Standardverfahren, um Mineralstoffmängel oder toxische Belastungen durch Schwermetalle zu diagnostizieren. Doch nicht jedes Blutelement eignet sich gleich gut zur Messung, da sich Schwermetalle und Mineralstoffe unterschiedlich im Körper verteilen.
Die Wahl des Blutmediums – Vollblut, Serum oder Plasma – hat einen erheblichen Einfluss auf die Aussagekraft der Ergebnisse.
|
Medium |
Vorteile |
Nachteile |
Geeignet für |
|
Vollblut |
- Erfasst intra- und extrazelluläre Anteile |
- Aufwendiger in der Analyse |
Schwermetalle, z.B. Blei, Quecksilber, Cadmium |
|
Serum |
- Standardisiert und leicht verfügbar |
- Nur extrazelluläre Werte |
Elektrolyte wie Natrium, Kalium |
|
Plasma |
- Ähnlich wie Serum, aber mit Gerinnungsfaktoren |
- Ähnliche Einschränkungen wie Serum |
Spurenelemente, gewisse Mineralstoffe |
Wichtige Unterschiede erklärt
- Vollblut wird für die Aussagekraft bei Schwermetallen wie Blei, Quecksilber, Cadmium bevorzugt, da diese oft intrazellulär (v. a. in Erythrozyten) gespeichert werden.
- Serumwerte geben bei Mineralstoffen wie Zink, Magnesium, Kalium oft nur extrazelluläre Konzentrationen wieder.
- Intrazelluläre Defizite können also bestehen, auch wenn die Serumwerte „normal“ erscheinen.
- Plasma und Serum unterscheiden sich hauptsächlich durch das Vorhandensein von Gerinnungsfaktoren; analytisch sind sie jedoch in vielen Fällen austauschbar.
- Chronische Expositionen mit Schwermetallen werden im Serum häufig unterschätzt, da diese Substanzen bevorzugt in Geweben oder Zellen akkumulieren.
Häufige Missverständnisse
- Akute vs. chronische Belastung:
Schwermetalle können sich im Gewebe ablagern – nicht immer ist Blut der beste Marker, v. a. bei chronischer Exposition. - Fluktuation durch Nahrung oder Stress:
Mineralstoffwerte im Serum unterliegen täglichen Schwankungen. - Falsche Interpretation durch falsches Medium:
Ein Patient kann z. B. "normales" Magnesium im Serum haben, aber einen intrazellulären Mangel, der nur durch Vollblut oder Erythrozytenanalyse sichtbar wird.
Fazit
Bluttests für Mineralstoffe und Schwermetalle bieten wertvolle Einblicke – wenn das richtige Medium gewählt wird. Während Serumtests gut für kurzfristige Veränderungen geeignet sind, liefern Vollblutanalysen präzisere Informationen über chronische Zustände oder Speicherveränderungen. Eine Fehlinterpretation kann leicht zur Fehldiagnose führen.
Ein guter Test braucht nicht nur ein gutes Labor, sondern auch eine fundierte Fragestellung und die richtige Probenart.
Dieser Artikel ersetzt keine individuelle ärztliche Beratung. Diagnostik und Therapie sollten immer durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Diese Fakten basieren auf Erkenntnissen aus der klinischen Labordiagnostik, Toxikologie und Nutritional Medicine. Zu den maßgeblichen Fachquellen zählen:
- Thomas L. (Hrsg.): Labor und Diagnose, 9. Auflage (2020)
Das deutschsprachige Standardwerk der Labormedizin. Verlag (Thieme) - DGKL – Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Fachgesellschaft für evidenzbasierte Laboranalytik in Deutschland.
→ https://www.dgkl.de - WHO – Biomonitoring and Exposure to Toxic Chemicals
Richtlinien zur toxikologischen Bewertung und Biomonitoring. - CDC – Biomonitoring Summary Reports
Umfassende Daten zu Metallen und anderen Umweltgiften im Blut und Urin.
→ CDC Biomonitoring Program
* Spurenelemente und Mineralstoffe (z. B. Magnesium, Zink, Selen, Kalium):
- Viele dieser Elemente sind vor allem intrazellulär gespeichert (z. B. 99% von Magnesium).
- In Vollblut hängt der gemessene Wert also auch stark vom Anteil der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) ab.
- Interindividuelle Schwankungen, z. B. durch Sport, Entzündung oder Dehydrierung, beeinflussen die Referenzbereiche stärker.
Schwermetalle (z. B. Blei, Quecksilber, Cadmium):
- Werden ebenfalls häufig intrazellulär gebunden (vor allem in Erythrozyten).
- Deshalb ist Vollblut das diagnostisch richtige Medium – aber:
- Die Normalwerte hängen stark von Alter, Region, Umweltbelastung und Labor-Methode ab.
Warum ist das wichtig ?
- Ein „hoher“ oder „niedriger“ Wert im Vollblut muss immer im Kontext interpretiert werden.
- Die Referenzbereiche (Normbereiche) für bestimmte Laborwerte im Vollblut sind weniger einheitlich und können stärker zwischen Laboren, Bevölkerungsgruppen und Analyseverfahren schwanken als z. B. im Serum
- Normbereiche aus einem Laborbericht sollten nicht verallgemeinert werden.